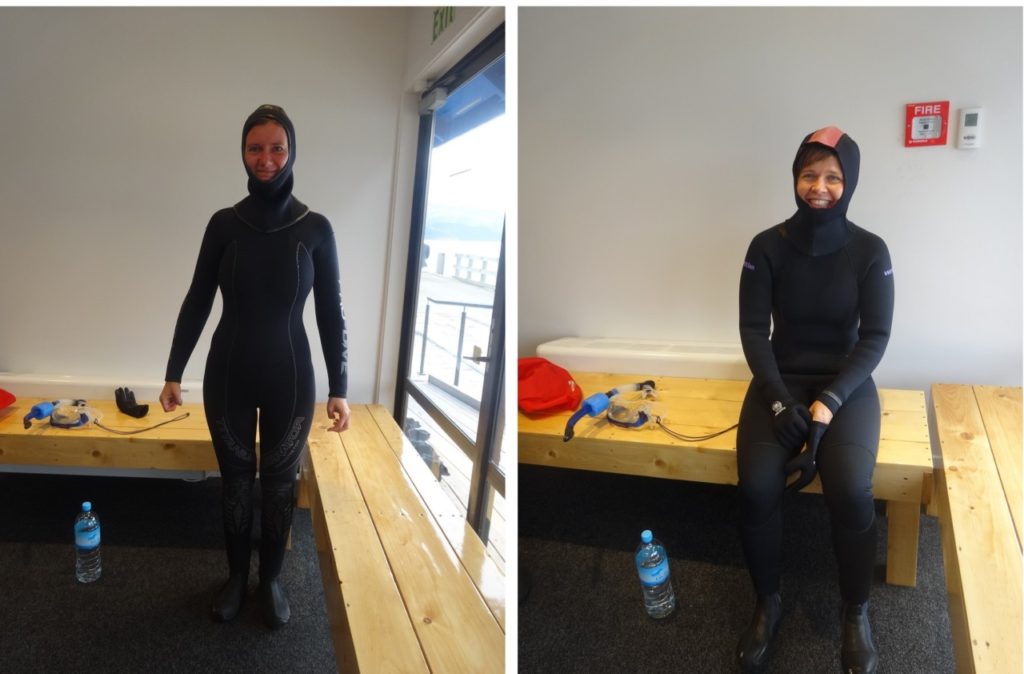Kleiner Hinweis vorab: wir waren heute ganz besonders fleißig und haben ganze drei (in Worten: drei) Beiträge hochgeladen. Dies hier ist Nummer drei, das heißt, darunter finden sich noch zwei weitere neue („Versteckte Wahrzeichen…“ und „Vom Schicksalsberg…“). Viel Spaß beim Lesen!
26. Juli 2017, Auckland
Bei Sonne (!) fuhren wir am nächsten Tag weiter die Küste entlang. Vor uns lag die riesige Bay of Plenty, die mit wunderschönen Stränden und Vistas bestach wie eigentlich jede Küstenregion Neuseelands. Wir gönnten uns sehr leckeren Fish & Chips (K) bzw. nur sehr leckere Chips (B) im kleinen Ort Opotiki, und nutzten endlich wieder einmal die modernen Segnungen des Internets für ein paar Reiserecherchen an einer der umfunktionierten Telefonzellen, die jetzt als Wlan-Hotspots dienen. Danach machten wir uns noch auf den Weg in die nächstgrößere Stadt Whakatane, überlegten es uns aber nach ein paar Kilometern anders, als wir die traumhaften Strände sahen. Stattdessen verbrachten wir dann lieber den Rest des Tages am Strand und telefonierten ein bisschen herum wegen einer Tour nach White Island, die wir für den nächsten Tag buchen wollten. Leider war sie schon ausgebucht und so mussten wir uns mit dem übernächsten Tag zufrieden geben, für den die Wettervorhersage schon wieder eher entmutigend war. Wir überlegten, stattdessen eine Reittour am Strand zu machen, aber aufgrund des vielen Regens der letzten Tage fanden keine statt, wie man uns auf dem Campingplatz sagte. Völlig unverhofft erhielten wir am Abend aber einen Anruf vom Veranstalter der White Island Tour, dass wir nun doch schon am nächsten Tag mitfahren könnten, umso besser, auch wenn das zeitiges Aufstehen bedeutete, da wir ja noch eine Stunde Fahrt nach Whakatane vor uns hatten.
White Island ist eine Insel etwa 50 km vor der Küste in der Bay of Plenty und gleichzeitig der östlichste Gipfel auf der Vulkanlinie, die unter der Nordinsel verläuft. Das Besondere an diesem etwa 700 Meter hohen Vulkan ist, dass der größte Teil unter dem Meeresspiegel liegt und nur der Krater mit seinem bis zu 300 Meter hohen Rand aus dem Wasser schaut. Das Boot legt also direkt auf Höhe des Kraters an – bequemer kann man kaum auf einen Berg steigen. 😉

White Island ahoi!
Die Überfahrt von Whakatane dauert etwa anderthalb Stunden bei halbwegs ruhiger See, die wir glücklicherweise hatten. Die Sonne wärmte uns trotz der steifen Brise und die einzigen Wölkchen am Himmel waren die, die aus dem Vulkan aufstiegen. Da die Tour extrem wetterabhängig ist und die Vorhersage für den nächsten Tag schon wieder schlechter war, hatte sich der Veranstalter entschieden, mit zwei Booten zu fahren und die Leute, die wie wir eigentlich keine Plätze mehr bekommen hatten, umzubuchen, wenn sie damit einverstanden waren. Wir waren nicht die einzigen, die auf diese Weise einen Tag vorgerutscht waren. Glück gehabt.
Zu Beginn der Bootsfahrt verteilte die freundliche Crew kleine braune Tüten an einige seekranke Passagiere, gegen Ende gab es Helme und Gasmasken für alle – White Island ist ein aktiver Vulkan, durch dessen Krater wir in ein paar Minuten laufen würden…

Ankunft am ‚einladenden‘ Strand von White Island
Die beiden Boote ankerten ein Stück vor dem alten Pier, einst für die Schwefelmine auf der Insel errichtet, und von dort wurden wir in mehreren Gruppen mit einem Gummiboot an Land gefahren. Jede Gruppe war mit einem eigenen Guide unterwegs und wir erhielten, kaum dass wir an Land waren, erst einmal eine gründliche Einweisung. Die oberste Regel lautete, immer genau hinter dem Guide herzulaufen und nicht vom Weg abzukommen, da der Boden im Krater an vielen Stellen nur wenige Zentimeter dick ist – zu erkennen an so genannten heat bumps, von einer dünnen Kruste überzogenen Wölbungen im Boden, wo man sehr leicht einbrechen würde. Jeden Tag werden drei bis vier Erdbeben auf der Insel verzeichnet, meist für Menschen nicht spürbar. Da der Vulkan aber auch jederzeit ohne Vorwarnung ausbrechen kann, wobei er meist nur Asche und etwas Geröll spuckt, erklärte unser Guide uns auch, wo wir im Falle eines Ascheregens oder Erdrutsches am Kraterrand Schutz suchen bzw. wie wir die Insel im Ernstfall schnellstmöglich wieder verlassen würden. Sonderlich gefährlich scheint es aber trotzdem nicht zu sein; nach dem letzten größeren Ausbruch vor 17 Jahren wurden die Touren schon zwei Tage später wieder aufgenommen, wobei die Teilnehmer damals durch die knietiefe Asche wie durch Schnee stapften mussten, und auch unser Guide erzählte, wie sie erst kürzlich eine Gruppe vor einem Hangrutsch in Sicherheit bringen musste – kein Grund, die Tour vorzeitig abzubrechen. Am Ende dieser motivierenden Einstimmung ließ sie noch eine große Box mit Bonbons herumgehen, aus der wir uns kräftig bedienen sollten – die beim Lutschen entstehende Flüssigkeit bildet im Rachen einen Film, der gegen die Reizung durch das Schwefelgas hilft. Ansonsten konnten wir auch jederzeit ein paar Züge durch die Gasmaske nehmen, wenn es mit der Luft mal knapp werden sollte.
Und dann liefen wir los, vorbei an roten und gelben Felswänden, kochenden Fumarolen (Spalten, aus denen Wasserdampf mit einer Temperatur von 180 bis 600°C aufsteigt), trügerisch solide wirkenden heat bumps und über ominös dampfende Bäche, immer mit leicht erhöhtem Puls, ob es denn plötzlich eine Eruption geben könnte. Es gibt wohl kaum einen Ort, an dem man sich dem Mittelpunkt der Erde näher fühlt als hier – die Magmakammer liegt an manchen Stellen nur 500 Meter unter der Krateroberfläche.
Nach ein paar hundert Metern erreichten wir einen Absatz oberhalb des Kratersees, den am weitesten vom Hafen entfernten Ort unserer Tour. Der See war sehr flach und lag ein ganzes Stück unterhalb unseres Standortes, aber laut unserem Guide war das nicht immer so gewesen. Nur wenige Jahre zuvor hatte der Pegel so hoch gestanden, dass der See fast über den Rand schwappte und den Boden dort mit so saurem Wasser tränkte, dass es den Guides die Sohlen von den Schuhen löste. Manche Bäche im Krater haben einen PH-Wert unter Null (-0.4 oder sogar -0.6, wenn wir das richtig verstanden haben), ein Vielfaches von Batteriesäure. Die Guides, die jeden Tag dort herumlaufen, brauchen etwa alle drei Monate neue Schuhe, und für die Touristen gibt es am Hafen ein Schuhwaschbecken. Nichtsdestotrotz konnten wir aus einem weniger sauren Bach sogar einmal das Wasser kosten, es schmeckte sehr metallisch, und eine chinesische Familie und ich gönnten uns gleich noch eine kostenlose Schlammpackung für samtweiche Hände. Selbst der Niederschlag auf der Insel ist sauer, da er durch den vulkanischen Dampf fällt, vor allem wenn es nieselt und die Tröpfchen entsprechend langsam unterwegs sind. Den Guides bleicht es dadurch mit der Zeit sogar die Kleidung.

Eine andere Gruppe steht am Rand des Kratersees.

Dampfende Bäche…

…dampfende Spalten…

…und überall stinkt es nach Schwefel…

…aus den zahlreichen Fumarolen.
Am Ende der Tour besichtigen wir noch die Überreste der alten Schwefelfabrik, die hier samt ihren Arbeitern einige Jahrzehnte den extrem widrigen Bedingungen getrotzt hatte. Die Arbeitsplätze waren gut bezahlt aber sehr gefährlich. Von der ersten Zwölfergruppe Männer, die auf die Insel kamen um Schwefel abzubauen, starb einer bei der Explosion eines Schwefeltanks, einer begang Selbstmord indem er sich in den Kratersee stürzte, und die restlichen zehn wurden im Schlaf von einem Erdrutsch verschüttet. Am längsten hielt ein Mann durch, der acht Jahre lang seinen Vertrag immer wieder verlängerte und der wohl trotzdem danach noch ein langes Leben bei bester Gesundheit genoss. Am kürzesten hingegen war ein anderer Arbeiter dort, der sich beim Anblick der Insel an den Schiffsmast kettete und sich weigerte, von Bord zu gehen – selbst wir waren länger dagewesen. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass in der Stellenbeschreibung von Arbeit auf einer pazifischen Insel die Rede gewesen war, was im Grunde genommen zwar stimmte, aber vielleicht doch falsche Vorstellungen geweckt hatte. Man sollte also immer das Kleingedruckte lesen.

Verrosteter Schwefeltank
Wir wuschen unsere Schuhe in den bereitgestellten Becken am Pier und wurden mit dem Gummiboot wieder zurück an Bord gebracht, begeistert und überwältigt, und vielleicht auch ein kleines bisschen erleichtert (oder in einigen Fällen enttäuscht), dass der Vulkan nicht ausgebrochen war, während wir durch seinen Krater stapften. Auf der Rückfahrt gab es eine Lunchbox für jeden und der Skipper machte noch ein paar Stopps entlang einiger Felsen vor der Insel, auf denen sich Robben sonnten.
Der Ausflug nach White Island war definitiv ein Highlight, das wir so schnell nicht vergessen werden. Und als es am nächsten Tag schon wieder grau und regnerisch wurde, waren wir umso glücklicher, dass uns dieser eine Sonnentag vergönnt gewesen war.